„Sharing is caring“ – der Spruch gehört zwar eigentlich nicht in den Kontext von Freund:innenschaften und doch könnte man irgendwie sagen, dass es ein Erfolgsrezept dafür ist: Du vertraust mir etwas an, ich vertraue dir etwas an. Dadurch sind wir auf einer ähnlichen Wissensebene und verstärken das Band, das wir zwischen uns knüpfen. Auch die Wissenschaft zeigt, dass dieses gegenseitige Anvertrauen Freund:innenschaften stärker, intensiver und bedeutungsvoller macht. Und trotzdem fällt es mir oft schwer, mich darauf einzulassen.
Ich bin nicht der größte Fan davon, über mich selbst zu sprechen. Ehrlich gesagt bin ich oft eine kleine, sehr verkrampfte Muschel, die ihr Inneres nicht offenbaren will. Deshalb antworte ich auf Fragen, die mir eigentlich die Rampe dafür bieten sollen, knapp und neutral, z.B. „Ach, ist nicht viel los“ oder „alles entspannt“. Vielleicht fasle ich noch irgendwas über die Arbeit oder Urlaubspläne und dann gebe ich den Ball ganz schnell wieder an mein Gegenüber ab, am besten noch, indem ich ganz konkrete Fragen stelle: „Wie geht es dir mit dieser Situation?“ oder „Hat sich Joseph nochmal gemeldet?“.
Mein Herumtänzeln um meine persönlichen Themen führt dann oft dazu, dass sich Gespräche ausführlich um die anderen Personen drehen und ich fast schon wie eine Therapeutin zurückgelehnt (es fehlt nur noch ein Notizbuch) mein privates Ich fast gänzlich aus der Situation verbanne.
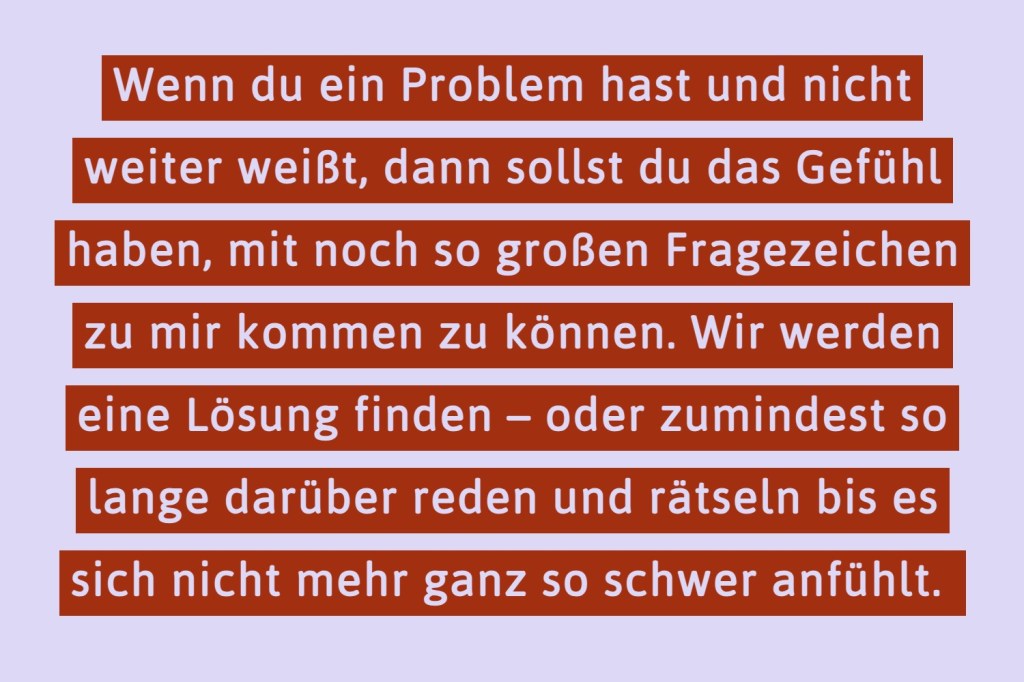
Das Problem und die Lösung gibt’s bei mir nur im Paket
Dabei ist sicherlich auch bei mir nicht immer „alles entspannt“. Nur suche ich dann keinen Rat, sondern möchte, wenn ich davon erzähle, das jeweilige Drama auch schon so sortiert haben, dass ich die Reflektion und Lösung direkt mitliefern kann. Wenn ich die Lösung dann aber schon gefunden habe, erzähle ich nicht mehr davon, weil ich den Rat der anderen Person nicht mehr brauche und das Ganze dann ja nicht mehr von Belang ist. Zumindest glaube ich das.
Dabei funktionieren Freund:innenschaften ja genau darüber: Wenn du ein Problem hast und nicht weiter weißt, dann sollst du das Gefühl haben, mit noch so großen Fragezeichen zu mir kommen zu können. Wir werden eine Lösung finden – oder zumindest so lange darüber reden und rätseln bis es sich nicht mehr ganz so schwer anfühlt. Und ich weiß, dass ich genau solche Freund:innenschaften auch habe: Denn, wenn es ganz selten doch vorkommt, dass ich und meine Gefühle und Erlebnisse zum Fokusthema des Gesprächs werden – dass ich mich wirklich öffne in Momenten, in denen ich nicht weiterweiß oder von etwas berichte, bei dem ich selbst noch keine Antworten für mich gefunden habe – dann habe ich auf jeden Fall auch mit einigen Menschen in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es mir auch weiterhilft, mit ihnen darüber zu sprechen. Dass sich Knoten in meinem Kopf lösen, ich mich verstanden fühle und merke, dass ich nicht alleine mit manchen Alpträumen bin. Doch zu oft halte ich mich eher zurück. Und das hat, glaube ich, mehrere Gründe.
Ängste, Kontrolle und Oversharing
In erster Linie habe ich, mehr als ich mir eingestehen möchte, Angst davor, falsch interpretiert zu werden und infolgedessen Einschätzungen zu bekommen, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich haben das alle, die sich eher seltener öffnen – das Gefühl, man könnte mich und meine kruden Gedanken eh nicht verstehen. Oder, dass das Gegenüber die eigenen Ängste auch noch bestätigen könnte.
Dazu kommt auch das unangenehme Gefühl, das sich bei mir oft einschleicht, wenn ich glaube, „Oversharing“ betrieben zu haben. Meistens passiert das dann eher, wenn ich etwas getrunken habe oder wenn ich mich vielleicht auch nicht ganz freiwillig öffne. Wenn jemand mich so gezielt ausfragt, dass ich mich fast nicht mehr traue, meine Antworten zu verweigern. Mich zu sehr geöffnet zu haben und zu sehr in mein Inneres blicken zu lassen, ist etwas, das mir großes Unbehagen bereitet. Wahrscheinlich, weil ich dann das Gefühl habe, jemand anderes hätte nun auch den Schlüssel zu meiner geheimen Gedankenkiste und könnte mein Inneres einfach so klauen und an andere weitergeben. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, ist es echt ein Problem für mich, die Kontrolle darüber, was ich über mich an wen preis gebe, abzugeben.
Das merke ich gerade auch immer wieder, wenn ich an der Reihe bin, einen Text für diesen Blog zu schreiben. Unsere Texte leben nämlich von unserer Offenheit und unseren persönlichen Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen. Immer wieder bekommen wir Nachrichten von Menschen, die sich darin wiederfinden und froh sind, dass wir dieses und jenes Thema mal ausgesprochen haben. Und so schön das auch ist, ich hadere immer mehr mit dem Gedanken daran, wer diese Texte und damit meine persönlichen Erzählungen lesen könnte. Wo ich in der Anfangsphase des Blogs einfach wild drauf losgeschrieben habe – fast wie in eine Art Tagebuch, sitze ich jetzt immer öfter vor meinem Bildschirm und verwerfe ein Thema nach dem andere, weil ich das Gefühl habe, es wäre zu privat und ich würde die Deutungshoheit darüber abgeben, sobald der Text einmal online ist.
Das Privileg von vielen Anlaufstellen
Doch neben diesen Ängsten und Befürchtungen spielt noch etwas anderes hinein, dass ich mich gerade gegenüber Freund:innen nur bedingt öffne. Vor einer Weile hatte ich dazu eine sehr lange Diskussion mit einer Freundin: Wir haben über eine andere Person gesprochen, die wohl auch eher seltener von ihren eigenen Gefühlen berichtet. Meine Freundin war dabei der Ansicht, dass es nicht gut für die mentale Gesundheit sei, wenn man nichts oder nur sehr wenig von seinen Problemen und Gedanken mit seinem Umfeld teile. Ich, die sich dabei irgendwie auch angesprochen gefühlt hat, bin also sofort in Verteidigungshaltung gegangen und habe die Position vertreten, dass es eher eine Typsache sei: Manche brauchen das Sharing eben doll und berichten allen ihren Freund:innen ausführlichst von den aktuellen Entwicklungen in ihrem Leben und andere, wie beispielsweise ich, brauchen das eben nicht so. Ich mache das lieber mit mir selbst aus oder muss das zumindest nicht mit all meinen Freund:innen ausführlich besprechen. Eigentlich wollte ich damit nur sagen: An beidem ist nichts verwerflich und gesund oder ungesund. Meine Diskussionspartnerin hat mir dann aber versucht einen Spiegel vorzuhalten und meinte, ich hätte auch mehr Optionen, um meine Gefühle und Erlebnisse einzuordnen, die ich meistens als erstes ansteuern würde, bevor ich mich an mein restliches Umfeld wende: allen vorweg meine Therapie, aber auch meinen Partner und meine Familie. Und vielleicht hat sie damit auch wirklich ein bisschen recht. Ich öffne mich schon und spreche über meine Gedanken, Probleme und Gefühle ohne die Lösung immer parat zu haben. Nur nutze ich meistens zuerst eine von meinen anderen Anlaufstellen, um das Chaos aufzuräumen, bevor ich mich bei Freund:innen melde. Und dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass ich in dieser Hinsicht auch doll priviligiert bin. Andere, die diese vielen Anlaufstellen vielleicht nicht haben, sind dann eben mehr auf „Sharing is Caring“ mit Freund:innen angewiesen als ich. Wahrscheinlich würde ich dann auch viel öfter den Rat meiner Freund:innen suchen.
Und wenn ich mich zurückerinnere, dann war dieses Muster auch nicht immer so bei mir vertreten – denn als fast erwachsene Teenagerin hatte ich natürlich auch schon überfordernde Gefühle oder Dramen in meinem Leben. Aber was ich nicht hatte, war eine Therapeutin, einen Partner oder keine Scham vor meiner Familie. Damals habe ich einfach ALLES mit meinen Freund:innen geteilt. Viel wahrscheinlicher ist also doch, dass mir diese Fähigkeit und der Komfort, mich bei Freund:innen auch mal in einem unsortierten Zustand zu offenbaren irgendwo along the line abhanden gekommen ist.
Aktiv gegen das Ungleichgewicht
Bestehen bleibt jetzt trotzdem, dass durch mein Nicht-Sharing das Gleichgewicht von „du vertraust mir etwas an, ich vertraue dir etwas an“ in manchen Konstellationen etwas aus der Balance geraten ist. Auch wenn es kurzfristig für mich ganz gut funktioniert, merke ich, dass es langfristig doch einseitig sein kann und Freund:innenschaften davon nicht unbedingt stärker werden. Ich versuche also mehr aus mir herauszukommen und ergänzend zu meinen ersten Anlaufstellen auch häufiger auf meine Freund:innen zurückzugreifen. Schließlich kann es auch immer sein, dass mein stabiles Netz aus Ansprechpartner:innen irgendwann nicht mehr gegeben ist. Und abgesehen davon möchte ich dann auch nicht nur als die Therapeutin auftreten, die ihre Privatheit komplett aus dem Gespräch außenvor lässt. Es fällt mir gerade noch nicht so leicht, aber ich hoffe darauf, dass die Übung mich damit langsam warm werden lässt.
Und vielleicht kriege ich damit auch meine Scheu vor dem „Ansprechen“ von Dingen, die mich in Freund:innenschaften stören in den Griff – aber das spare ich mir für einen anderen Text auf (wenn ich mich dann auch traue, das mit euch zu sharen 👀).

Von Chiara (27): Chiara mag stilles Wasser, aber still ist sie selbst nicht gerade – ganz im Gegenteil. Sie tanzt durch’s Leben und spricht und schreibt über Feminismus, Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit. Sie ist Kopf- und Herzmensch zugleich, Ungerechtigkeit macht sie wütend und sie hat eine Schwäche für die Kardashians, gutes Essen und die Menschen, die sie liebt.

