Ein halbes Jahr in Kanada auf die Schule gehen, nach dem Abi mehrere Monate um die Welt reisen oder ein Auslandssemester in Dublin, Riga oder Seoul. Viele Menschen in meinem Umfeld haben genau diese Erfahrungen auf ihrer Bucket List abgehakt. In einem fremden Land ganz auf sich allein gestellt zu sein – das klingt für ganz schön viele wie DER Traum schlechthin. Für mich nicht.
In der Schule war ich nicht die aufmerksamste Zuhörerin, doch ich habe das Glück, dass mir mein Vater den Mathe-Stoff mit einer Eselsgeduld zu Hause beigebracht hat. Ich durfte auch Klavier lernen und wurde von meiner Mutter jahrelang zum Ballettunterricht gefahren. Damit will ich sagen: Ich bin privilegiert aufgewachsen und hatte wahrscheinlich mehr Chancen als andere. Deshalb konnte ich mir auch ernsthafte Gedanken darüber machen, ob ich nach dem Abi eine teure Reise oder später dann ein Auslandssemester machen möchte. Ich hätte mir für diese Möglichkeiten natürlich auch ein zusätzliches finanzielles Polster erarbeiten müssen – das war aber nicht der Grund, weshalb ich diese Optionen früher oder später immer wieder vom Tisch gewischt habe. Während meine Freund:innen also monatelang Neuseeland, Australien, Hawaii oder Südostasien entdeckt oder in Dublin, Berkley oder Seoul studiert haben, saß ich im deutschen Winter und habe nine to five gearbeitet.
Einmal Pippi, immer Pippi?
Man könnte meinen, das wäre einfach veranlagt: Manche Menschen sind „von Natur aus“ ganz wild auf Abenteuer. Sie lieben es, sich immer wieder in ungewohnte Situationen hineinzuschmeißen, um dann daran zu wachsen. Andere Menschen wiederum hören ihren Abenteuer-Freund:innen gerne zu – aber brauchen den Nervenkitzel einfach nicht, um glücklich zu sein. Ja, ich weiß, binäre Schubladen sind oft zu kurz gedacht. Aber wenn ich die Menschheit in diesem Text in zwei Schubladen stecken müsste, dann stünde auf der ersten Schublade „Pippi Langstrumpf“ für all die mutigen Abenteurer:innen und auf der anderen „Annika“ – für Menschen wie mich.
Während meiner Kindheit hätte man eigentlich meinen können, ich würde zu einer klassischen Pippi heranwachsen. Ronja Räubertochter, Pünktchen oder Sprotte von den Wilden Hühnern: allesamt Mädchen, die für Abenteuer, Mut und starke Meinungen stehen, die ihr eigenes Ding machen. Und allesamt waren sie Vorbilder und Identifikationsfiguren für mich. Ich war schon als kleines Kind immer eher die laute Draufgängerin. Das hat sich auch im Vergleich mit meinem Bruder gezeigt, der in unserem Duo die Gegenseite eingenommen hat: ich Pippi, er Annika.
Es gibt Videos von uns, wie wir beide nebeneinander auf einem Straßenfest festgekettet an Bungee-Trampolinen hängen. Zu sehen bin ich, die versucht, so hoch wie möglich zu springen und sich bei jedem Flug mit Vorwärts- und Rückwärts-Salti im Kreis schleudert. Daneben mein Bruder. Er schaut gequält, weint vielleicht sogar, scheint überhaupt keinen Spaß zu haben und macht, wenn überhaupt, ein paar kleine Hopser.
Ähnlich zeigte sich dieser Gegensatz auch bei unserer ersten Übernachtung bei Oma: Ich hatte die beste Zeit meines Lebens und fand es einfach nur aufregend, das erste Mal ohne meine Eltern bei jemand anderem zu übernachten. Dementsprechend genervt war ich auch davon, dass mein Bruder das scheinbar ganz anders gesehen hat und meine Eltern uns noch in der Nacht abholen mussten. Es hat noch mindestens einen weiteren Versuch gebraucht, bis er dann auch auf den Geschmack gekommen ist, bei Oma Kakao vor dem Fernseher zu trinken und die Zubettgehzeit komplett auszureizen.
Doch als wir älter wurden haben mein Bruder und ich uns beide in die jeweils andere Richtung entwickelt. Nach der Schule war er es, der sechs Monate um die Welt gereist ist, während ich nach der Schule ein FSJ gemacht und weiterhin bei meinen Eltern gewohnt habe. Irgendwann zwischen der Grundschule und meinem Abi habe ich also ganz leise die „Pippi Langstrumpf“-Schublade aufgeschoben, bin rüber in die „Annika“-Schublade geklettert und habe meine Abenteuerlust zurückgelassen. Aber warum?
Das Problem mit dem Worst Case
Viel wahrscheinlicher liegt es, wie bei vielen Phänomenen, die unsere Persönlichkeit betreffen, nicht nur an unserer „Natur“, sondern auch an unserem Umfeld und den Erfahrungen, die uns auf besondere Art und Weise geprägt haben. Eine davon war wahrscheinlich ein sagenumwobener Englandaustausch in der sechsten Klasse: Denn obwohl meine Vorfreude und Abenteuerlust riesig waren, hat sich der Trip ziemlich genau fünf Stunden nach Abfahrt zu meinem persönlichen Albtraum entwickelt. In meiner Stufe und unter meinen Freund:innen ist diese Reise nämlich vor allem dafür in Erinnerung geblieben, dass ein gewisses Mädchen 16 Stunden lang durchgekotzt hat (ja, das war ich und kein Scherz – alle fünf Minuten musste eine neue Tüte her). In England angekommen, könnte man meinen, das Schlimmste wäre überstanden. Aber als Zwölfjährige alleine, komplett durch den Wind, dehydriert und geschwächt in einer fremden Familie anzukommen, deren Sprache man noch nicht allzu gut versteht – das war einfach zu viel für mich. Kurzum: Immer, wenn ich nicht auf den Gruppenausflügen mit meinen Freundinnen zusammen war, hat sich starkes Heimweh in meiner Brust ausgebreitet, ich wollte einfach nur noch nach Hause zu meiner Familie.
Während mein Bruder also bei seinen Abenteuern eher gelernt hat, dass es zum Beispiel ganz cool sein kann, bei Oma zu übernachten oder allein im Ausland zu sein, hat sich mein erstes Auslands-Abenteuer direkt in ein Worst-Case-Szenario entwickelt und gezeigt: Auch wenn es dir im Ausland nicht gut geht, bist du ziemlich doll auf dich allein gestellt. Mama und Papa können nicht einfach so kommen und dich trösten.
Zurück in den Sattel
Vielleicht kennt ihr ja auch dieses schlaue Sprichwort: Bist du vom Pferd gefallen, musst du so schnell es geht wieder aufsteigen. Auch wenn das vielleicht eine alte Bauernweisheit ist, beschreibt es im Prinzip eines der wichtigsten Mittel gegen Ängste: die „Konfrontationstherapie“. Das Wiederaufsteigen hat den Sinn, dass der Angst erst gar keine Chance bleibt, sich in deinem Kopf einzunisten und breit zu machen. Sie würde nämlich auch dafür sorgen, dass man das Risiko, vom Pferd zu fallen, nicht nochmal eingeht – egal wie doll man Reiten doch liebt. „Vermeidung“ ist da das große Wort, das viele Angstpatient:innen wahrscheinlich sehr gut kennen.
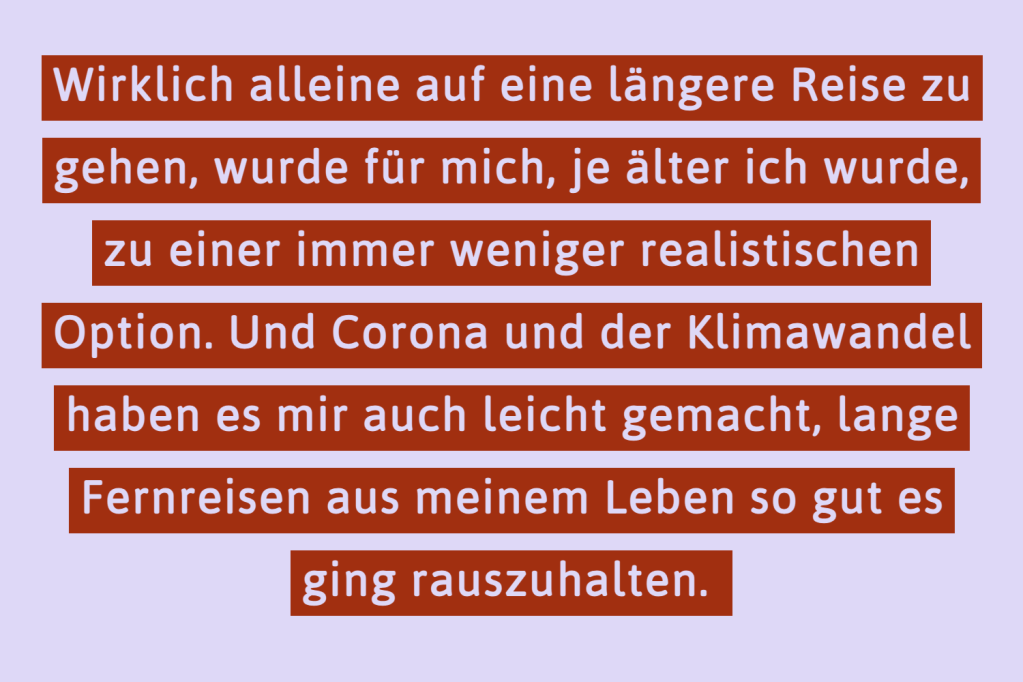
An sich ist es ja ganz schlau, nicht jedes Risiko einzugehen: zum Beispiel nicht einfach so von einem hohen Baum zu springen und zu testen, ob man fliegen kann. Aber bei anderen Dingen, bei denen das Risiko zum einen nicht so hoch ist und man zum anderen eigentlich ein Bedürfnis danach hat, ist die Angst dann eher ein Hindernis als hilfreich.
Ich habe also meine Auslandsabenteuer nochmal angepackt und versucht, meine Angst zu überwinden. Doch immer, wenn ich allein oder in einem nicht so „wohlfühligen“ Umfeld war, hat sich das Heimweh erneut eingeschlichen. Jahre später hat sich sogar das Kotz-Drama wiederholt: Meine erste Überseereise ohne Eltern habe ich mit einer achtstündigen Kotz-Tortur im Flugzeug und einem Krankenhausaufenthalt in einem New Yorker Randbezirk begonnen. Und bei all diesen Reisen, gespickt mit Heimweh und Kotzen, waren wohl gemerkt immer noch Freund:innen bei mir.
Wirklich alleine auf eine längere Reise zu gehen, wurde für mich, je älter ich wurde, zu einer immer weniger realistischen Option. Und Corona und der Klimawandel haben es mir auch leicht gemacht, lange Fernreisen aus meinem Leben so gut es ging rauszuhalten. Ich habe es mir also in der „Annika“-Schublade bequem gemacht und mir irgendwann einfach eingeredet, ich wäre „einfach nicht der Typ für sowas“.
Sei Pippi, sei Annika
Auch wenn auf Facebook früher bunte Sharepics mit dem Spruch „Sei Pippi, nicht Annika!“ geteilt wurden, möchte ich das jetzt aber auch nicht so darstellen, als wäre es problematisch, eher Annika als Pippi zu sein. Denn wenn sich etwas nicht gut anfühlt, sollte man sich auch nicht dazu zwingen. Als ich mich damals gegen ein Auslandssemester in Prag entschieden habe, obwohl ich eine Zusage hatte und fast alle meiner Freund:innen auch ins Erasmus gegangen sind, hat mir eine Freundin diesen Satz gesagt: „Es ist auch ein Zeichen von Stärke, sich gegen etwas zu entscheiden.“ Und irgendwie hat mir das damals gut getan. Denn in unserer Generation und Bubble wird das Reisen und Weltentdecken auch sehr doll zu etwas aufgebauscht, das JEDE:R UNBEDINGT MACHEN MUSS. Als wäre man sonst mangelernährt oder so. Dabei kann ich von mir sagen: Auch wenn ich mich manchmal frage, ob ich vielleicht einen gewissen Pfad meiner Persönlichkeits-Entwicklung dadurch nicht richtig ausgekostet habe – ich glaube nicht, dass ich deswegen wirklich einen „Mangel“ habe.
Ja, manches habe ich im Nachhinein bereut, nicht gemacht zu haben. Anderen Erfahrungen hingegen trauere ich nicht hinterher. Und ehrlich gesagt: Ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass ich nicht mehr so oft in der Pippi-Schublade abhänge. Aber es gibt auch die andere Seite in mir, die vielleicht irgendwie bei mir veranlagt ist. Und auch durch das Schreiben dieses Textes habe ich insgeheim erkannt, dass ich mich eine Weile ein bisschen dagegen versperrt habe, wieder aufs Pferd zu steigen. Ich habe also angefangen, Abenteuer in kleinen Dosen auf mich zu nehmen. Abenteuer, bei denen ich mich zwar ein bisschen aus meiner Komfortzone herausbewege, aber trotzdem noch so viel unter Kontrolle haben kann, dass ich mich dabei zumindest in gewisser Weise sicher fühle. Abenteuer, bei denen meine Pippi in mir meine Annika an der Hand nehmen und ihr die Welt zeigen kann.

Von Chiara (27): Chiara mag stilles Wasser, aber still ist sie selbst nicht gerade – ganz im Gegenteil. Sie tanzt durch’s Leben und spricht und schreibt über Feminismus, Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit. Sie ist Kopf- und Herzmensch zugleich, Ungerechtigkeit macht sie wütend und sie hat eine Schwäche für die Kardashians, gutes Essen und die Menschen, die sie liebt.

