Ich bin oft im Tunnel – vor allem bei der Arbeit. Das ist erst mal nicht verkehrt, schließlich ist man dort bekanntlich am fokussiertesten. Aber wenn man deshalb permanent über lange Zeiträume hinweg die Verbindung zur Außenwelt verliert, sollte man dann nicht vielleicht mal Grenzen setzen? Ich stelle mir gerade die Frage: Wie oft bin ich hochgerechnet eigentlich überhaupt im Hier und Jetzt? Und wenn ich am Ende meines Lebens dann zurückblicke: War es das wert?
Ich weiß noch, wie sehr ich es als Kind geliebt habe, zusammen mit meinen Geschwistern ins vollgepackte Familienauto gemümmelt, die Nacht durch in den Urlaub zu fahren, damit wir im Morgengrauen ankommen und „noch was vom Tag haben“. Nicht nur einmal sind wir dabei durch den fast 17 Kilometer langen Gotthardtunnel gefahren – eine wichtige Verbindungsroute durch die Alpen nach Italien. Für mich war der Tunnel nicht nur eine dunkle Röhre, die uns von einem Ort zum anderen brachte, sondern vielmehr eine ganz eigene Welt. Immer, wenn wir als Kinder in einen Tunnel gefahren sind, haben meine Schwestern und ich den Tunnel begrüßt mit „Hallo, Tunnel!“ und beim Rausfahren verabschiedet mit „Tschüss, Tunnel!“.
In Tunneln ist man abgeschottet von der Außenwelt und unausweichlich gefangen im Inneren einer Betonsäule – irgendwie eine beängstigende Vorstellung. Vor allem, wenn man (wie ich) Probleme mit Platzangst hat. Aber irgendwie hatten Tunnel für mich trotzdem immer auch etwas von Geborgenheit. Und ich wusste immer: Am Ende kommt ein heller Punkt, der immer heller und größer wird. Und je näher man ihm kommt, desto besser wird die Autoradio-Qualität. Und dann war man wieder draußen.
Eine Reise mit vielen Tunneln
Manchmal fühlt sich mein Leben für mich wie eine große Reise an, auf der ich durch sehr viele, teilweise sehr lange Tunnel fahre. Denn auch, wenn ich je nach Situation dazu neige, kleinste Reize aus meiner Umgebung aufzunehmen, wie Schwingungen, Gerüche oder Geräusche: Sobald ich im sprichwörtlichen Tunnel bin, ist alles andere weg. Der Fokus ist gesetzt, die Zeit verfliegt, und oft sorge ich in dieser Betonsäule auch nicht gut für mich. Weil ich das große Ganze ausblende und für mich der einzige Weg zum Licht ist, einfach pausenlos durchzuziehen. Mal kurz rechts ranzufahren und den Notausgang zu nehmen, um Luft zu schnappen, sehe ich nicht ein. Ich will schließlich nicht den Verkehr aufhalten.
Von Montag bis Freitag bin ich jeden Tag stundenlang im Tunnel, wenn ich arbeite. Und wenn ich sage „im Tunnel“, meine ich so richtig krass, ohne zwischendurch was zu essen. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe es inzwischen tatsächlich irgendwie perfektioniert, mich von der Außenwelt abzuschotten, um zu funktionieren und mich „auf’s Wesentliche“ zu konzentrieren.
Schlimm an der Sache ist auch, dass ich dieses ungesunde Verhalten insgeheim manchmal auch von anderen erwarte. Einerseits bewundere ich oft Leute, die bei der Arbeit bewusst auf Pausen achten und darauf, nicht zu überlastet zu sein. Aber ein ganz komischer, kleiner Teil in mir, für den ich mich auch echt schäme, schreit immer mal wieder „Junge, sei stattdessen mal lieber produktiv“. So kaputt denkt aber nur mein Tunnel-Ich. Mein normales Ich findet das lächerlich.
Wasser ist wesentlich
Wegen „auf’s Wesentliche konzentrieren“: Dass ich vielleicht nochmal überdenken sollte, was „das Wesentliche“ eigentlich ist, merke ich immer erst, wenn ich aus dem Tunnel raus bin und das Außen kein Rauschen mehr ist, sondern meine spürbare Umgebung, die ich erst dann wieder bewusst wahrnehme.
Wirklich „wesentlich“ wäre es zum Beispiel, zwischendurch mal einen Schluck Wasser zu trinken oder etwas zu essen. Oder mal kurz aufzustehen und den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Tatsächlich eine Mittagspause zu machen und sie nicht nur in der Zeiterfassung anzugeben. Mir bewusst zu machen, dass ein kurzes Abschweifen ja auch Inspiration schaffen kann. Generell mal zu überdenken, dass ich vielleicht auch leistungsfähiger bin, wenn ich ein bisschen mehr auf mein eigenes Wohlergehen achte. Kurz: Ich sollte meine Prioritäten überdenken.
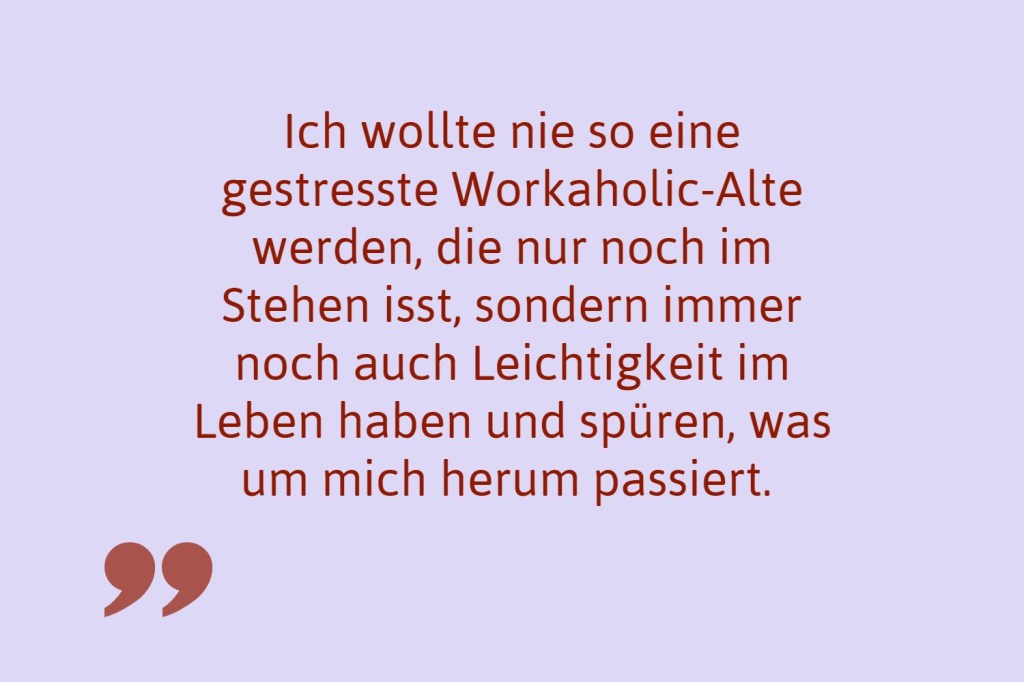
Das ist mir vor allem jetzt bewusst geworden, weil ich in der letzten Zeit super oft einfach puren Stress empfinde und ungefähr zehnmal am Tag die Wort-Kombi „Ich muss“ benutze. Was muss ich eigentlich? In erster Linie doch: gar nichts. Aber gesund und ganz gut drauf bleiben, wäre schön.
Ich wollte nie so eine gestresste Workaholic-Alte werden, die nur noch im Stehen isst, sondern immer noch auch Leichtigkeit im Leben haben und spüren, was um mich herum passiert. Auch wenn mir meine Arbeit Spaß macht und mir viel bedeutet, sie soll bitte nicht mein ganzes Leben ausmachen.
Vielleicht stelle ich mir also in Zukunft kleine Pausenwecker. Oder lösche die Teams-App von meinem Handy. Oder halte mich länger in schönen Hobby-Tunneln auf, zum Beispiel dem Musik-Tunnel oder dem Zeichnen-Tunnel. Denn da war ich schon ziemlich lange nicht mehr drin.
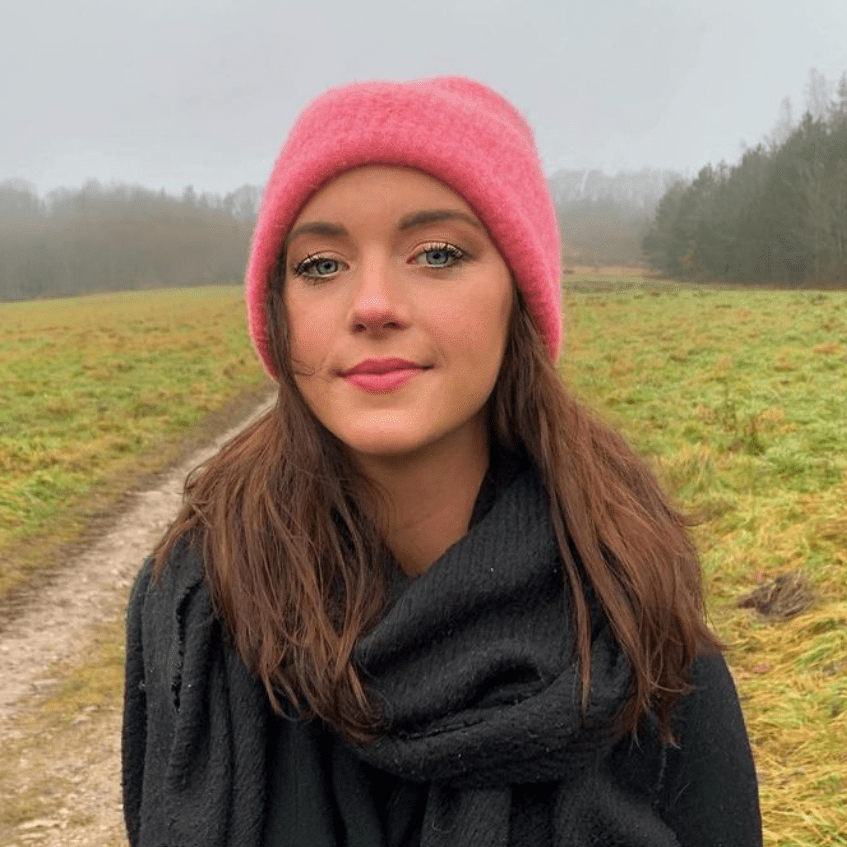
Von Fee (29): Während Fee sich früher noch Kurzgeschichten über böse Punker ausgedacht hat, schreibt sie heute als Journalistin lieber Texte über die Gefühle ihrer Generation, über gesellschaftliche Missstände und inspirierende Menschen. Manchmal macht sie auch einen Fernsehbeitrag darüber. Ihr Mitbewohner sagt, sie wäre etwas zu vorwitzig und sollte weniger Fragen stellen, aber sie sieht das anders. Immer am Start: Empathie, der Wunsch, mehr von der Welt zu sehen und Hündin Martha.


1 Kommentar